Forschung - 12.09.2025 - 10:30
Vom Staat wird zunehmend erwartet, dass er umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen kauft, um die ökologische Nachhaltigkeit zu fördern und den CO2-Fussabdruck zu verringern. Bereits im Jahr 2021 trat das revidierte Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen in Kraft, das den Behörden das Ziel vorgibt, Waren und Dienstleistungen «wirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltig» zu beschaffen. Die Praxis, bekannt als «Green Public Procurement» (GPP), nutzt die Kaufkraft der Regierung, um den Markt zur Schaffung nachhaltiger Optionen zu bewegen, Innovationen zu fördern, grüne Industrien zu schaffen und umweltpolitische Ziele zu erreichen. Dabei fällt auf, dass einige Länder in der Lage sind, diese Ziele besser zu erreichen als andere. Die HSG-Assistenzprofessorin und Rechtsexpertin Désirée Klingler hat sich mit diesem Thema befasst und die Praxis der «grünen» Beschaffung in der Schweiz analysiert.

Wie lautete der Name Ihres Projekts?
Das Buch Green Public Procurement: Lessons from the Fields war Teil des Forschungsprojekts «Contract Public et Développement Durable» (CPEDD), koordiniert durch französische Universitäten. Im Rahmen des Projekts habe ich Daten über nachhaltigen Beschaffungspraktiken in der Schweiz gesammelt. Meine Kollegen untersuchten andere Länder, darunter Kanada, Frankreich, Italien, Portugal und die Niederlande.
Warum haben Sie sich auf dieses Thema konzentriert? Was wollten Sie herausfinden?
In vielen Ländern, darunter auch in der Schweiz, wurden neue Gesetze verabschiedet, um Behörden zur nachhaltigen Beschaffung zu ermutigen. Aber das Recht ist nur eine Seite der Medaille. Ob Behörden tatsächlich nachhaltiger einkaufen, ist unklar. Meine Umfrage ist die erste Studie in der Schweiz, die Daten zur Praxis der ökologischen öffentlichen Beschaffung von Einkäufern auf Bundes-, Kantons- und Gemeinde-Ebene erhebt.
Wie schneidet die Schweiz im Vergleich zu in diesem Bereich führenden Ländern wie Schweden oder den Niederlanden ab?
Basierend auf den Umfrageergebnissen liegt die Schweiz bei der praktischen Umsetzung von GPP an der Spitze, dicht gefolgt von den Niederlanden. Die Umsetzung in Kanada, Frankreich und Portugal scheint langsamer und fragmentierter zu sein. Ausserdem befürworten über 70 % der Fachstellen eine obligatorische Überwachung von Umweltkriterien – das ist mehr als in Portugal oder Kanada, was darauf hindeutet, dass die Schweiz der GPP-Durchsetzung positiver gegenübersteht.
Wir müssen jedoch berücksichtigen, dass Umfragen nur die Wahrnehmung von Menschen widerspiegeln und es auch zu Stichprobenverzerrungen kommen kann. Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass die meisten Länder nachhaltige Beschaffung anhand der Ausschreibungen bewerten und nicht anhand der Endprodukte, wie beispielsweise, ob ein Gebäude bei der Fertigstellung tatsächlich nachhaltig ist. Das bedeutet, dass sich auch Behörden des Risikos von Greenwashing bewusst sein müssen.
Wie definiert die Schweizer Regierung «grün»?
Das ist nicht nur in der Schweiz, sondern in den meisten Ländern eine knifflige Frage. «Grüne Beschaffung» ist kein Rechtsbegriff, sondern ein Überbegriff. Das revidierte Beschaffungsgesetz fordert die Regierung auf, öffentliche Mittel auf «ökologisch nachhaltige» Weise auszugeben. Als «grün» können also die Kriterien und technischen Eigenschaften eines Produkts verstanden werden, die zum Schutz der Umwelt und des Ökosystems beitragen und dabei die Lebenszykluskosten des Produkts berücksichtigen. Beispiele für «grüne» Produkte sind Textilien mit FSC-Label, recycelbarer Beton, Gebäude mit einem Energiekonzept wie Minergie oder IT-Hardware mit dem «Blauen Engel». Aber auch Lieferanten können «grün» sein. Eine wichtige Norm ist ISO 14001, welche Unternehmen mit einem wirksamen Umweltmanagementsystem zertifiziert.
Ist die Definition «grün» in allen Regierungsbehörden einheitlich? Gibt es Konflikte?
Da es keine gesetzliche Definition und keine abschliessende Liste gibt, was als «grün» gilt, gibt es Unterschiede zwischen Bundesämtern, aber auch zwischen kantonalen und kommunalen Behörden. Also ähnlich wie beim EU-Leitfaden zu GPP-Kriterien, der Nachweise wie Umweltzeichen und Standards für verschiedene Produktkategorien definiert, hat die Schweizer Regierung Leitlinien zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung herausgegeben und eine Wissensplattform mit Produktegruppen-Merkblättern eingerichtet, die Informationen darüber enthalten, welche Standards und Umweltzeichen beim Kauf nachhaltiger Waren und Dienstleistungen verwendet werden können. Da diese Instrumente nicht verbindlich sind, können die verschiedenen Behörden und regionalen Einkäufer ihre eigenen Definitionen und Instrumente anwenden.
Was macht die Schweiz gut?
Um GPP zu fördern, investiert die Schweiz in Schulungen und Leitlinien: Rund 60 % der Befragten nahmen an Schulungen teil und profitierten von praktischen Hilfsmitteln. Fast 90 % der Befragten verwenden Umweltzeichen, Standards und Zertifikate, vor allem für Gebäude. Beamte berichten auch, dass sie Umweltinformationen in Angeboten häufig überprüfen können – ein bekanntes Hindernis bei der nachhaltigen Beschaffung – und dass in 50 % der Beschaffungsverträge, Umweltklauseln verwendet werden, die überwacht und überprüft werden. Die Haupttreiber für die Umsetzung der ökologischen Beschaffung sind politischer Druck und persönliche Überzeugungen.
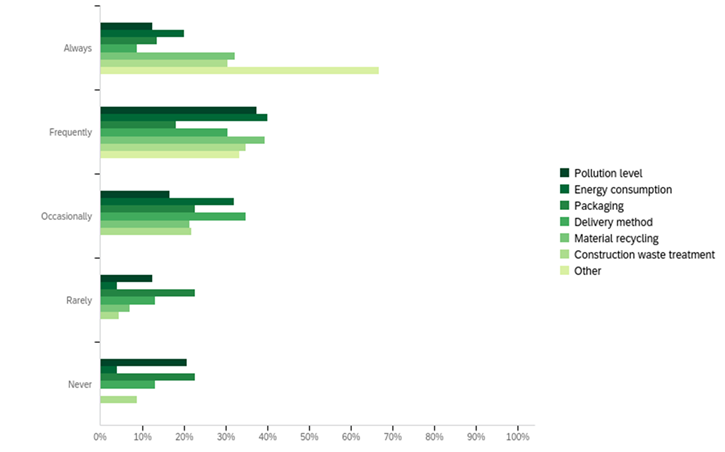
Das von Ihnen mitverfasste Buch «Green Public Procurement» schaut aber auch auf andere Länder wie Kanada, Frankreich und den Niederlanden. Können wir etwas von deren Herangehensweise lernen?
Ein wesentlicher Unterschied zu den Niederlanden besteht darin, dass die Rahmenbedingungen und die Umsetzung von GPP aufgrund langjähriger EU-Praxis als klar und einheitlich wahrgenommen werden. In der Schweiz hingegen ist das revidierte Gesetz relativ neu (2021) und die Umsetzung noch uneinheitlich, insbesondere auf lokaler Ebene. Das zeigt, wie wichtig eine einheitliche Praxis und klare Leitlinien sind, um die Durchsetzung von GPP in der Schweiz voranzutreiben.
In welchen Bereichen kann die Schweiz die ökologische öffentliche Beschaffung verbessern?
Was gemessen wird, kann gesteuert werden. Zuverlässige Daten sind der erste Schritt – und das Hauptziel dieser Studie. Nur wenn wir über zuverlässige Daten aus verschiedenen Behörden und Produktkategorien verfügen, wissen wir, wo wir stehen, wo die Hindernisse sind und wo wir uns verbessern müssen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die persönliche Einstellung der Beschaffungsbeamten. Die rechtliche Grundlage für nachhaltige Beschaffung ist vorhanden, aber ob die Beamten davon Gebrauch machen, hängt stark von ihrer persönlichen Überzeugung ab.
Laut der Umfrage sind die beiden grössten Hindernisse für die Umsetzung von GPP in der Schweiz fehlendes Fachwissen und höhere Verwaltungskosten. Schulungen – insbesondere auf lokaler Ebene –, aber auch der gezielte Einsatz von Experten können dazu beitragen, Fachwissen aufzubauen und die Risikoscheu von Beamten abzubauen. Mehr Fachwissen hilft auch, Zeit und Kosten zu sparen. Obwohl Outsourcing ein sensibles Thema in der öffentlichen Verwaltung ist, ist es fast unmöglich, alle Standards, Labels und technischen Eigenschaften nachhaltiger Produkte zu kennen, vor allem für lokale Beamte. Daher kann die Einbeziehung von Umweltexperten eine grosse Stütze sein.
Das Buch: «Green Public Procurement: Lessons from the Fields».
Désirée Klingler ist Assistenzprofessorin für Verwaltungsrecht unter besonderer Berücksichtigung der Sustainable and Smart City Governance.
Bild: Adobe Stock / Pakin
Weitere Beiträge aus der gleichen Kategorie
Das könnte Sie auch interessieren
