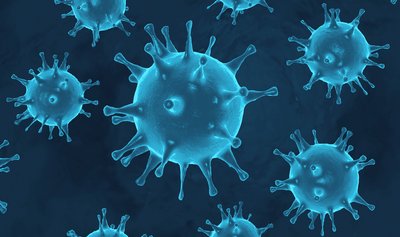Forschung - 11.07.2023 - 14:44
«Das französische Integrationsmodell ist schon lange bankrott»
Krawalle wie jene, die Frankreich aktuell beschäftigen, wird es laut dem HSG-Staatswissenschaftler Christoph Frei immer wieder geben. Denn die Gewalt auf den Strassen, so sagt Frei im Interview, gründet massgeblich auf zwei systemischen Problemen: Ein gescheitertes Integrationsmodell einerseits, anderseits der weitgehende Ausschluss der Bürgerschaft von politischen Entscheidungsprozessen.

Christoph Frei, Sie haben sieben Jahre in Paris gelebt und geforscht und setzen sich als Wissenschaftler seither intensiv mit der französischen Politik auseinander. Welche tiefen liegenden Gründe haben aus Ihrer Sicht zu den Krawallen geführt?
Der Tod des 17-jährigen Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle war auch hier nur der aktuelle Auslöser. Die unterliegenden Ursachen sind Teil des politischen und sozialen Systems von Frankreich. So sind die Menschen, die in den Banlieues aufwachsen und Migrationshintergrund haben, praktisch von Geburt an sozial ausgegrenzt. Sie haben so gut wie keine Chance auf eine vernünftige Ausbildung oder Arbeitsstelle. Daraus, aber auch aus alltäglichen, spannungsvollen Konfrontationen mit den Ordnungskräften, resultiert ein abgrundtiefes Misstrauen gegenüber einem Staat, der doch zuverlässig öffentliche Güter wie Bildung, Sicherheit oder Gesundheitsversorgung bereitstellen müsste. Diese Menschen erleben täglich, dass das französische Integrationsmodell, das auf Akkulturation unter gleichen Bedingungen für alle setzt, längst bankrott ist.
Wie sieht dieses Integrationsmodell aus?
Es fügt sich ein in einen republikanischen Universalismus, der sich konzeptuell bis auf die Französische Revolution zurückverfolgen lässt. Im Kern besagt es, dass es unter den Menschen in Frankreich keine Unterschiede geben darf, die auf der Zugehörigkeit zu ethnischen oder religiösen Gruppen beruhen – dass vielmehr alle die gleichen Rechte und Pflichten haben. Aber eben, gerade die Rechte sind für die Bewohnerinnen der Banlieues weitgehend fiktiv. Interaktionen mit dem äusseren Umfeld sind von Xenophobie, Rassismus und Ausgrenzung geprägt. Der französische Staat mit seinen Organen und Institutionen verdrängt derweil, was nicht sein darf. In Erhebungen wird zum Beispiel nicht nach der religiösen Zugehörigkeit gefragt, weil diese in der republikanischen Theorie keine Bedeutung haben darf.
Dass der Staat die realen Probleme gleichzeitig nur verwaltet, statt sie glaubwürdig zu bekämpfen, ist eine nie versiegende Quelle von Frustration. An dieser Stelle kommt ein zweites grosses, strukturell verankertes Problem ins Spiel. Gemeint sind fehlende Möglichkeiten, Frustrationen über reguläre demokratische Institutionen ventilieren zu können. Französische Citoyens und Citoyennes haben keinerlei Möglichkeit, politische Entscheidungen aktiv zu beeinflussen. Das «Referendum der Strasse», allzu häufig verbunden mit Chaos und Gewalt, steht als funktionales Äquivalent – es ist ein quer durch die Gesellschaft akzeptiertes Mittel, sich Gehör zu verschaffen. Gewalt gehört buchstäblich seit Jahrhunderten zur französischen politischen Kultur.
Hat Sie das Ausmass der Gewalt in den aktuellen Krawallen dennoch überrascht?
Nein. Schon bei Protesten der Gelbwesten 2018 und bei Demonstrationen gegen die Rentenreform in den vergangenen Monaten kam es über Monate hinweg zu massiven Ausschreitungen. Und machen wir uns nichts vor: die nächsten Ausschreitungen auch in den Banlieues kommen bestimmt, weil sie eben massgeblich auf systemisch und kulturell verankerten Problemen beruhen. Da ist, erstens, der soziale und ökonomische Ausschluss ganzer Bevölkerungsgruppen; da sind zweitens, fehlende Möglichkeiten, sich in politische Entscheidungsprozesse einzubringen. Zwar wählt das Stimmvolk alle fünf Jahre einen Präsidenten ebenso wie ein nationales Parlament, ansonsten aber bleibt die Bürgerschaft der Republik ausgeschlossen. Faktisch wird Frankreich von einer politischen Elite gelenkt, die wenige Tausend Personen zählt. Das französische Parlament ist mit das schwächste der westlichen Welt, die Exekutive hat ein massives Übergewicht. Ein Quervergleich: in der Schweiz können wir uns jährlich und auf verschiedenen Ebenen rund 30 mal äussern – wir können als Bürger vielfach ventilieren. In Entsprechung dazu kennt die politische Kultur der Schweiz den Einsatz von Gewalt heute kaum.
Braucht Frankreich politische Reformen?
Grundlegende Veränderungen wären nötig, ja – aber das ist eine Generationenaufgabe, die unter anderem in neue Sozial-, Bildungs- und Städtepolitiken münden müsste. Vor allem aber bräuchte Frankreich endlich ein Integrationsmodell, das die Realität seiner Immigration, die Wirklichkeit einer enorm heterogenen Bevölkerung anerkennt.
Grundlegende Reformen wird es auch weiterhin nicht geben. Vielmehr schaltet die Regierung, wie immer in solchen Situationen, in den Modus der Hyperaktivität. Früher oder später wird sie ein 10- oder 12-Punkte-Programm erlassen, mehr Geld in Schulen investieren – und so weiter. Um aber die grundlegenden Probleme anzugehen, müsste die politische Elite einen politischen Willen zur Veränderung aufbringen, der nachhaltig trägt. Dafür sehe ich keine Anzeichen. Und so führen die immer wiederkehrenden Missstände dazu, dass die Menschen ihr Vertrauen in die Politik weiter verlieren. Tiefe Stimmbeteiligungen bei den staatspolitisch unbedeutenden Regionalwahlen sind ein Abbild dieser Stimmungslage.
Christoph Frei ist HSG-Titularprofessor für Politikwissenschaft mit besonderer Berücksichtigung der internationalen Beziehungen.
Weitere Beiträge aus der gleichen Kategorie
Das könnte Sie auch interessieren
Entdecken Sie unsere Themenschwerpunkte