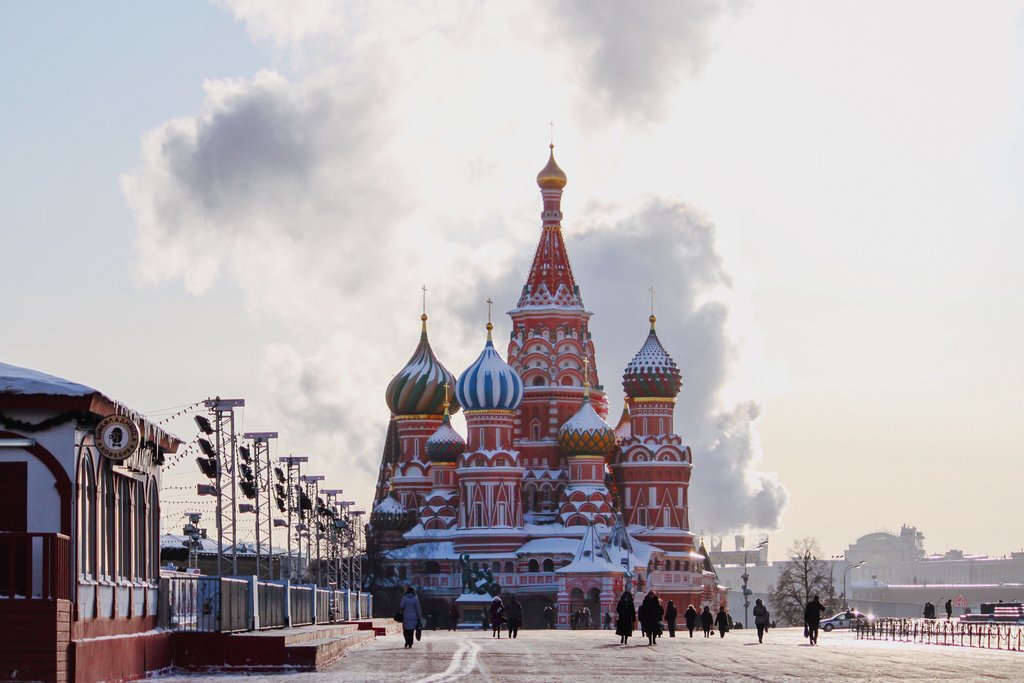Forschung - 06.11.2025 - 10:00
Bisherige Forschungen zur Haltung der russischen Gesellschaft zum Ukrainekrieg konzentrierten sich oft darauf, die Unterstützung für den Krieg oder das Ausbleiben von Widerstand zu erklären. «Die gesellschaftlichen Konsequenzen sind jedoch noch weitgehend unerforscht», sagt Prof. Dr. Ulrich Schmid von der School of Humanities and Social Sciences der Universität St.Gallen (SHSS-HSG). Gemeinsam mit seinem Kollegen Prof. Dr. Jan Matti Dollbaum von der Universität Fribourg leitet er ein neues vom Schweizerischen Nationalfonds mit CHF 897'910 gefördertes Forschungsprojekt, das verschiedene Auswirkungen untersucht: Wann und warum tolerieren und unterstützen russische Bürger staatliche Repression oder lehnen sie ab? Wie wirkt sich der Krieg auf das Solidaritätsverhalten verschiedener gesellschaftlicher Gruppen aus? Und wie werden die sich ändernden staatlichen Narrative und Wahrheitsansprüche in der Bevölkerung wahrgenommen, verarbeitet und möglicherweise in Frage gestellt?
Um diese komplexen Fragen zu beantworten, setzen die Forschenden auf Umfragen, Tiefeninterviews, ethnografische Methoden und die Analyse von Textdaten. «Das Erheben von soziologischen Daten in einem autoritär regierten Land, das sich in einem Krieg befindet, ist nicht einfach», sagt Ulrich Schmid. Einerseits gebe es rechtliche Schranken: «In Russland werden kritische Äusserungen zum Krieg als ‘Diskreditierung der russischen Streitkräfte’ oder als ’Verbreitung von Fake News’ mit hohen Gefängnisstrafen geahndet. Andererseits gibt es in Russland einen ‘organisierten Konsens der Nichtablehnung des Krieges’.» Zudem sei die Bevölkerung unter den langen Jahren der Putin-Herrschaft depolitisiert worden. Aus früheren Projekten verfügen die Forschenden jedoch über Erfahrung in indirekten Fragetechniken und der vertrauenssichernden Organisation von Fokusgruppen, die ihnen auch in diesem Projekt zugutekommen wird. Dabei sollen hohe ethische und methodische Standards gewährleistet sein.
Das Forschungsprojekt startet im Januar 2026 und dauert vier Jahre. Die Ergebnisse der Studien sollen auch über Russland hinaus für das allgemeinere Verständnis moderner autoritärer Regime von Bedeutung sein. «Russland ist eine ‘informationelle Autokratie’: Die Macht des Kremls beruht nicht in erster Linie auf offener Repression, sondern auf einer umfassenden Beeinflussung der Öffentlichkeit», sagt Ulrich Schmid. Das Forschungsprojekt will das komplexe Wechselspiel zwischen Elementen solcher informationellen Autokratien und klassischen autoritären Politiken, die auf Furcht, Ideologie und Zwang basieren, beleuchten.
Weitere Beiträge aus der gleichen Kategorie
Das könnte Sie auch interessieren
Entdecken Sie unsere Themenschwerpunkte