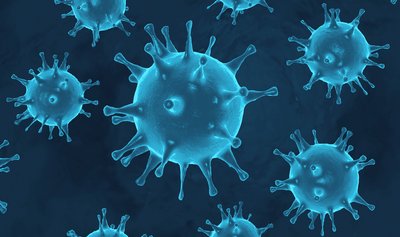Meinungen - 10.05.2016 - 00:00
Warum setzen wir auf Wachstum?
Spätestens seit dem Bericht des Club of Rome vor 44 Jahren leben wir zunehmend mit einem Gefühl des Unwohlseins angesichts des Fundaments, auf dem ökonomisches Wachstum basiert. Die Vorstellung einer Stagnation ist eine Bedrohung. Ein Kommentar von Martin Kolmar, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität St.Gallen.

11. Mai 2016. Wir haben ein eigentümlich gespaltenes Verhältnis zu ökonomischem Wachstum. Spätestens seit dem Bericht des Club of Rome vor 44 Jahren leben wir zunehmend mit einem Gefühl des Unwohlseins angesichts des Fundaments, auf dem ökonomisches Wachstum basiert. Dieses Unwohlsein wird gerade in materiell wohlhabenden Ländern dadurch verstärkt, dass für viele unklar ist, ob die Lebensform, die mit materiellem Wohlstand einhergeht, einem gelingenden Leben zuträglich ist oder ob sie – anders als in Ländern mit materieller Armut, in denen ökonomisches Wachstum viel Gutes tun kann – vielmehr Teil des Problems geworden ist: Wachstum gemessen am Sozialprodukt eines Landes ist kein gutes Mass für die Steigerung des Wohlergehens einer Gesellschaft; zu viele wichtige Aspekte dessen, was hierfür wichtig ist, werden vernachlässigt.
Wachstum: Eine Frage der Perspektive?
Und ökonomisches Wachstum geht einher mit Schrumpfungen in nicht ökonomisch berücksichtigten Bereichen wie Biodiversität. Weiterhin basiert ökonomisches Wachstum auf der Verfügbarkeit von Energie, über deren Nachhaltigkeit wir nur spekulieren können. Und viele sind sich irgendwie einig, dass das Bevölkerungswachstum global zu gross ist, gleichzeitig fürchtet man Bevölkerungsrückgang in den eigenen Gesellschaften. Wachstum: eine Frage der Perspektive, der Werte?
Gleichzeitig sehen wir ein reflexartiges Festhalten an der Idee des ökonomischen Wachstums, insbesondere zur Bewältigung der zahlreichen Krisen. Die Vorstellung einer Sekularen Stagnation ist eine Bedrohung: die Idee auch des materiellen Wachstums erscheint für das eigene Leben attraktiv. Und auf gesellschaftlicher Ebene basieren Probleme der Privat- und Staatsverschuldung, der Sozialversicherungssysteme etc. auf einer Kettenbrieflogik, die umso schwieriger aufrechtzuerhalten ist, je weniger Wachstum wir haben. Es zeigt sich auch, dass zivilgesellschaftliche Werte wie Toleranz, Offenheit und Vertrauen in demokratische Prozesse in Zeiten ökonomischer Stagnation und Schrumpfung insbesondere der Mittelschicht in der Vergangenheit oft Schaden genommen haben und derzeit wieder nehmen.
Spannungsverhältnis von innerem und äusserem Wachstum
Wie geht man mit diesem Spannungsverhältnis um? Gibt es einen nicht aufzulösenden Konflikt zwischen ökonomischem Wachstum und Nachhaltigkeit, Respekt vor grösseren ethischen Zusammenhängen wie Biosystemen und so etwas wie Lebenszufriedenheit? Zwei Thesen hierzu:
1. Schaut man sich viele der Probleme an, die man mit ökonomischem Wachstum beheben möchte, sieht man, dass sie in ihrem Kern eigentlich Verteilungsprobleme sind. Dies gilt innerhalb einer Generation hinsichtlich der Verteilung von Einkommen und Lebenschancen, aber auch zwischen den Generationen hinsichtlich der Finanzierung von Sozialsystemen, Staatsschulden und auch den Effekten vergangenen und gegenwärtigen Handelns auf die Umwelt, in der unsere Nachkommen leben werden. Ökonomisches Wachstum löst scheinbar Interessenkonflikte, indem es jeder Bevölkerungsgruppe verspricht, zu den Gewinnern zu gehören. Aber solange die Quellen zukünftigen und nachhaltigen Wachstums spekulativ sind, ist es ein Gebot der Klugheit, Verteilungsfragen als das anzuschauen, was sie sind, und nach gesellschaftlichen Modellen zu suchen, die fair sind und auch dann anerkannt werden, wenn sie nicht auf dem Versprechen zukünftigen Wachstums basieren.
2. In «westlichen» Gesellschaften übersetzt sich ein grösseres Sozialprodukt nicht mehr automatisch in eine höhere Lebenserwartung, bessere Gesundheit oder mehr Lebenszufriedenheit. Die Ursachen hierfür sind komplex. Ein Aspekt ist gewiss, dass Bedürfnisse nach sozialer Anerkennung und Status durch quantitatives Wachstum nicht für alle erfüllt werden können, da sie relational sind. Und zentrale Bedürfnisse lassen sich nicht gut in eine Güter- und Marktlogik einpassen. Wachstum ist nicht nur im Zentrum kapitalistischen sondern ist immer schon im Zentrum philosophischen und spirituellen Denkens gewesen. Allerdings lag dort, fast immer und weitgehend unabhängig von der konkreten Tradition, der Fokus nicht auf «äusserem» sondern auf «innerem» Wachstum, auf Autonomie. Das gelingende Leben wird als etwas gesehen, bei dem man sich von materiellen Bedürfnissen und Statusdenken weitgehend unabhängig macht. Inneres steht aus dieser Perspektive tatsächlich in einem Konflikt zu ökonomischem Wachstum, wenn die physiologischen Grundbedürfnisse befriedigt sind. Diese These findet in jüngerer Zeit viel Bestätigung in verschiedenen psychologischen Forschungsrichtungen. Vielleicht ist sie moderner, als man denkt.
Bild: Photocase / giftgruen
Weitere Beiträge aus der gleichen Kategorie
Entdecken Sie unsere Themenschwerpunkte